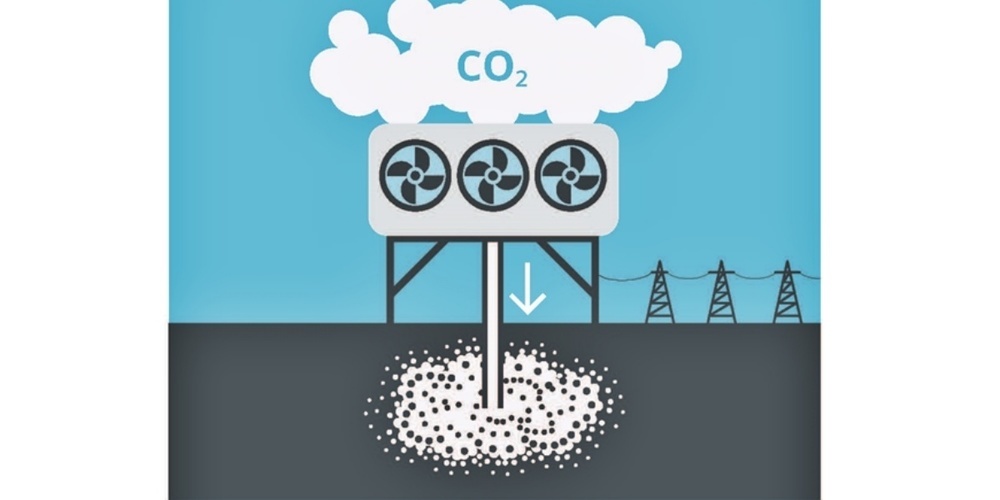Obwohl NET grundsätzlich dazu beitragen können, die Klimaziele zu erreichen, ist derzeit noch vieles unklar, schreibt die Empa in ihrer Mitteilung. Denn einige dieser Verfahren seien in der Praxis noch unerprobt, technisch komplex, kostspielig oder vorerst nicht in grossem Massstab einsetzbar.
Hinzu komme, dass viele Menschen sowohl über die Möglichkeiten als auch die Grenzen der NET erst wenig wüssten. Im Auftrag der TA-SWISS haben deshalb Forschende des Öko-Instituts und der Empa fünf für die Schweiz relevante NET unter Einbezug weiterer Experten evaluiert. Dabei habe sich gezeigt: Ein einzelnes Verfahren genügt nicht, es brauche alle NET. Ausserdem müsse die Reduktion des CO2-Ausstosses zentral bleiben. Denn: Emissionen zu vermeiden sei günstiger, als das CO2 nachträglich wieder aus der Luft zu entfernen.
TA-Swiss-Studie
Die TA-Swiss-Studie hat zum Ziel, Politik und Öffentlichkeit über Chancen, Grenzen und Risiken verschiedener Methoden zur CO2-Entnahme und Speicherung zu informieren. Dabei wurden Aspekte wie Machbarkeit, Klimawirksamkeit, Kosten, Ressourcenverbrauch und Auswirkungen auf Umwelt und Bevölkerung betrachtet.